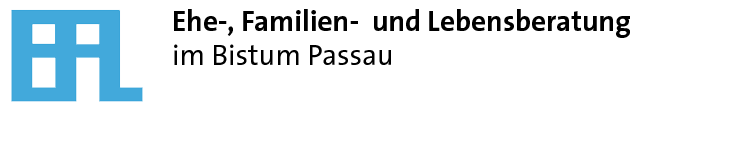
Telefon EFL-Regionalzentrum Passau: 08 51 / 3 43 37
Telefon EFL-Regionalzentrum Altötting: 0 86 71 / 18 62
30.03.2020
Im PNP-Gespräch gibt Helmut A. Höfl (62), Leiter der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Bistum Passau, Tipps und sagt: Streiten muss nicht schlecht sein.
Kein Ausflug in die Stadt, kein Treffen mit Freunden, Home Office. In Zeiten von Corona sitzt die Familie viel aufeinander. Was lässt sich tun, damit das nicht in Zank endet? Wie lässt sich Kritik konstruktiv üben?
Herr Höfl, über Wochen die Wohnung kaum mehr zu verlassen, das kann anstrengend sein für den Hausfrieden. Ist es normal, wenn man da mehr streitet?
Helmut Höfl: Mehr Streit ist nicht zwingend! Man kann den Hausfrieden auch in bedrängten Zeiten steuern, wenn man, so wie in der Gesellschaft auch, stützende Regeln hat, die gut ausgehandelt sind. Das ist vielleicht anstrengend, wenn man darin nicht geübt ist. Aber es kann auch wohltuend sein, wenn man als Familie in Krisenzeiten merkt: Wir kriegen das hin, wir schaffen das!
Was, wenn der Raum, auf dem man zusammenlebt, wirklich sehr beengt ist?
Höfl: Das Problem ist weniger die räumliche Nähe. Vielmehr braucht jeder Mensch einen “guten Platz innerhalb der Familie“. Dazu gehört zwar auch ein Rückzugsort. Wichtiger aber sind Reviere und klare Aufgaben. Wenn der Partner, der sonst bis abends in der Arbeit ist, ungefragt das Reich der Küche erobert und die eingespielten Routinen stört, schlägt das gut Gemeinte schnell ins Gegenteil um. Wenn Kinder, die wochentags in der Schule sind, spät aufstehen und ohne Rücksicht auf das “Wir“ ihren Tag planen, führt dies zu Konflikten.
In China soll die Scheidungsrate gestiegen sein...
Höfl: Das muss bei uns nicht passieren. In China hat die Ehe einen starken ökonomischen Hintergrund, der in so einer Krise leicht wegbricht. Ich denke, dass sich die Mehrheit bei uns schnell an die Veränderungen anpassen wird. Paarbeziehungen sind in unserer Kultur immerhin Partnerschaften, die aus Liebe und individueller Wahl entstehen. Natürlich, in vielen Vernunftehen mangelt es an Zeit füreinander. Die Liebe wird oft lange auf Eis gelegt, muss jedoch regelmäßig aufgetaut werden – vor ihrem Verfallsdatum! Dafür besteht jetzt sogar gewissermaßen die Chance.
Dann steigt vielleicht sogar die Geburtenrate?
Höfl: Es wäre jedenfalls ein paarpsychologischer Krisengewinn, wenn sich räumliche Nähe als neue Chance für Berührung, Zärtlichkeit, Blickkontakt, Teilen von Gefühlen, authentische Gespräche, kultivierte Erotik und lustvolle Sexualität herausstellen würde. Durch Zärtlichkeit und Sex wird der Neurotransmitter Oxytocin ausgeschüttet. Das vertieft die Verbundenheit. Und gibt den Paaren Sicherheit, besonders den Männern, die nicht gerne über ihre Sorgen sprechen. Wenn sich in der Krise die Liebe vertieft, kann sich das auf die Geburtenrate auswirken. Nebenbei: In der Natur vermehren sich Populationen in Krisenzeiten. Wir befinden uns gerade in einer demografischen Schieflage. Die Mittelschicht arbeitet sich fast zu Tode, dass man sich beinahe fragt, wo da Platz für Kinder bleibt. Insgesamt glaube ich, dass uns diese Zeit, wenn sie uns nicht allzu sehr in unserer Existenz bedroht, ein Stück Besinnung bringt auf das, was das Wesentliche im Leben ist.
Welche Strukturen empfehlen Sie, wenn beide Partner gleichzeitig im Home Office arbeiten?
Höfl: Am Arbeitsplatz hat gewöhnlich jeder seine Werkzeuge, seinen PC, seine Unterlagen. Im Home Office muss man sich die Ressourcen manchmal teilen. Jeder Partner hat verinnerlichte Ansprüche über Qualität und Ergebnis seiner Arbeit. Dazu gehört, sich auf Kunden oder Kollegen zu konzentrieren und ihnen Vorrang zu geben. Da übersieht oder übergeht man schnell seinen Partner! Es hat Sinn, sich für konzentrierte Tätigkeiten den Platz kurzzeitig zu reservieren oder sich für ein Telefonat anderswo zurückzuziehen. Wichtig ist auch, sich seiner Ideale von perfekter Arbeit in dieser Situation zu entledigen. Am wichtigsten aber ist, einen vielleicht sachlicheren oder härteren Ton aus der Arbeit nicht in die Partnerschaft zu “importieren“. Auch im Home Office bleibt man ein Paar!
Wie lassen sich im Home Office Grenzen für Kinder abstecken?
Höfl: Das erste sind klare Strukturen: Wann wird aufgestanden, gelernt und gearbeitet und gemeinsam gegessen? Wer kocht, wer hilft wem? Wann ist Zeit für Spielen und Entspannung? Je nach Alter können Kinder sich eigenständig beschäftigen und sie lernen ja: Alle arbeiten, reden jetzt nicht, alle sind gerade konzentriert bei der Sache. Dann “spielen“ sie das Home Office mit. Entscheidend ist, dass in dieser Zeit Smartphones, digitale Spiele und der PC stillgelegt sind – außer man braucht sie zur Erledigung der Aufgaben. Nach den Arbeitsphasen braucht es Pausen mit Belohnung, Lob. Ältere Kinder können Grenzen übrigens besser annehmen, wenn sie bei der Aushandlung beteiligt sind. Gerade sie brauchen Strukturen. Stehen sie gemächlich auf Mittag zu auf, essen allein und ziehen sich wieder in ihr Zimmer zum Computerspiel zurück, fühlen sie sich auf Dauer unwirksam, leer und unzufrieden. Eltern müssen ihren Kindern Sicherheit geben
Wie können Kinder ihre Energie “entladen“, ohne Spielplatz und Treffen mit Gleichaltrigen?
Höfl: Der Morgen und Vormittag ist Zeit der Sachlichkeit. Hier Kinder geistig und kreativ zu fordern, sie zum Lernen und Üben zu animieren, zieht Energie. Wer sich einen Morgenlauf oder frühen Hundespaziergang gönnt, wird frischer ans Werk gehen. In längeren Pausen liegen spielerische Gymnastik oder Körperspiele nahe – das Internet ist voll davon. Wichtig sind auch prosoziale Tätigkeiten: Die Großeltern anskypen, mit Freunden telefonieren, für Risikopersonen was Gutes tun wie Einkaufen, dem Vater im Garten helfen. So fühlen sie sich gebraucht. Natürlich können sie auch begrenzt digital spielen.
Welche Bedeutung hat Sport für den Familienfrieden?
Höfl: Sport fördert dann den Frieden, wenn er gewinnen lässt. Wenn er spielerisch und kreativ abläuft. Man kann einen Familien-Parcours erfinden, wo jeder nach seinem Können Erfolge erzielen kann. Oder mit einem Elternteil laufen und radeln und sich dabei neu erleben. Manche richten sich spielerisch ihr Fitness-Studio im Keller ein. Auch für den persönlichen Rückzug zu sich kann der Sport helfen. Der Sauerstoff, die Rhythmik, die Endorphine, die ausgeschüttet werden – das alles “reinigt“.
Wie kann man Kindern die Situation erklären?
Höfl: Kinder brauchen das sichere Gefühl: Unsere Eltern können mit der Lage umgehen. Wenn beide unter Hochspannung stehen, weil ihr Geschäft oder ihr selbstständiger Betrieb gefährdet ist, werden Kinder schnell von der Angst angesteckt. Das passiert auch, wenn die Eltern vom Virus infiziert sind oder eine Erkrankung befürchten. Wenn Angst und Panik die Situation beherrschen, ist der Weg zur Eskalation nicht weit. Deshalb brauchen Kinder Eltern, die signalisieren: Wir sind die Größeren, Älteren und Erfahrenen. Wir sind erwachsen und finden einen Weg. Die Situation erklärt man Kindern am besten, wenn die Bauchgefühle heruntergebrannt sind, die Partner ihre Nöte für sich besprochen haben. Kinder scheuen nichts mehr als traurige oder ängstliche Eltern.
Was, wenn die Gefühle dennoch “hochkochen“, z.B. sobald man kritisiert wird?
Höfl: Vielleicht hat man als Kind gelernt, dass Streiten nicht gut ist. Aber das stimmt nicht. Im Streit zeigen sich Spannungen und Konflikte. Was erzeugt Druck? Was stört, irritiert und verletzt uns? Gibt jemand zu viel in dieser Zeit und bekommt zu wenig? Sucht der eine das Ich, und lebt der andere das Wir? Zieht sich ein Teil zurück und der andere fühlt sich im Stich gelassen? Je besser man ausdrücken kann, welche Bedürfnisse man hat, umso besser versteht man die Gefühle, die hochkochen, wenn sie verletzt werden. Doch eins ist klar: Das gelingt nicht in jeder Familie! Manchmal muss es rumpeln. Dann aber gilt: Nur das störende Verhalten kritisieren, nicht den Menschen entwerten! Ärger, Wut und Jähzorn vergehen wieder. Lasse ich sie 20 Minuten verrauchen, braucht es das Schimpfwort nicht, das mir rausrutscht. Kritik übt sich am besten, wenn man entspannt ist und wie nebenbei anfängt: “Du, ich hab’ da was, darf ich Dir was Kritisches sagen?“ Das setzt allerdings auch voraus, dass man die eigenen Emotionen regulieren kann, das kann nicht jeder.
Ist mit einem Anstieg häuslicher Gewalt zu rechnen?
Höfl: Dort, wo Menschen massiv unter Stress stehen, sich beengt, bedroht und verletzt fühlen, werden Partner oft feindselig. Statt sich verletzlich zu zeigen, schützen sich Erwachsene durch Abschottung, Verachtung, Beleidigung und Gewalt. “Hilfe“ holen sie sich bei denen, die sie in ihrer Opferposition unterstützen . Deshalb geht es primär um Emotionsregulation: Was hilft mir, aus meinen feindseligen Opfer-Gefühlen herauszukommen? Oft hilft, sich zunächst um sich zu kümmern, sich gut zu sein. Leider können das viele Menschen nicht, die selber verroht und mit Gewalt aufgewachsen sind. Ihnen bleibt nichts Anderes in der Eskalation, als in den Kampf zu gehen, um dort zu siegen und sich momentan gut zu fühlen, wenn der Partner verliert, wenn er am Boden liegt. Häusliche Gewalt ist hochdestruktiv, besonders wenn Kinder Zeugen oder gar Opfer werden. Dann ist unverzüglich Hilfe zu holen und Schutz zu suchen! Erste Hilfe gibt es bei Polizei, Krisendiensten, Frauenhäusern, Weißem Ring... Auch jetzt in der Krise! Nachhaltige Hilfe bekommt man u.a. bei uns, in der EFL-Beratung, wo die Gewaltkreisläufe durchschau- und regulierbar gemacht werden können.
Was, wenn der Partner in Depression verfällt?
Höfl: Menschen mit Angst und Panik fürchten nicht selten die Nähe Anderer. Sie ziehen sich zurück, lenken ab, flüchten in künstliche Beruhigung durch Alkohol oder Medikamente – Sucht, v.a. Medikamentensucht, wird zunehmen, befürchte ich. Andere klammern sich so an ihre Partner, dass diese den inneren Rückzug antreten müssen. Partner sind keine Therapeuten! Vielmehr sollten Fachleute gesucht werden, mit denen man zumindest telefonisch abklärt, was zu tun ist. Klar, Depressionen sind in Ausnahmesituationen wie diesen oftmals episodisch und vergehen durch Tagesstruktur, Bewegung, Licht und gesundes Leben. Bleibt die Verstimmung aber, sollte man zügig fachliche Hilfe holen.
Könnte auch die Zahl der Suizide ansteigen?
Höfl: Leider ja! Da kann ich nicht so optimistisch sein wie bei den Scheidungen. Wir sehen als Ursache des Suizids oftmals eine nicht mehr kompensierbare Verzweiflung. Wir Menschen sind soziale Wesen, die unter Trennung, Kontaktverlust oder -abbruch und Isolation sehr leiden. Wer verletzlich, depressiv und sehr einsam ist, wird immer weniger Halt und Sinn finden. Insbesondere, wenn die Angst vorm Virus oder ellenlangen Quarantänen dazukommt. Wenn man jemanden über Suizid reden hört, gerade ältere, einsame Menschen, dann muss man das sehr ernst nehmen!
Was kann man gegen Einsamkeit tun?
Höfl: Alleinsein kann dann gut ertragen werden, wenn man in der Lage ist, mit sich in Beziehung zu gehen. Dabei hilft alles, was mir meine Biografie zeigen und wofür ich dankbar sein kann: Tagebücher, Fotoalben, Geschichten, Freundschaften. Einsamkeit ist oft verbunden mit einer Art Reserve gegenüber der Privatheit von Nachbarn oder Bekannten. Dabei spielt die innere Fantasie, zu stören, nicht willkommen oder gar unerwünscht zu sein, eine erhebliche Rolle. Hilfreich sind da Tiere oder Alltagsthemen, über die Kontakte viel leichter entstehen! Einsamkeit macht auf Dauer krank. Deshalb braucht es gerade in diesen Zeiten das Gefühl: Da draußen gibt es ein Du, an das ich mich wenden kann. Und das müssen nicht immer andere Menschen sein. Viele entwickeln das Bild, eine Freundschaft mit sich zu pflegen – und tun sich dann leichter, auf Andere zuzugehen. Oder sie suchen ein Du, das sie spirituell oder im Gebet finden. Religiosität und Spiritualität sind ein wichtiger Faktor. Zur Einsamkeitsbewältigung gehört aber auch, dass man mitkriegt, was draußen vor sich geht. Dass man sich über die Zeitung zum Beispiel darüber informieren kann.
Wie wäre es mit einem Videotagebuch für Oma? Was können Angehörige tun?
Höfl: Nehmen wir ein etwas vereinsamtes Großelternteil, das derzeit unter Kontaktarmut leidet: Was hält Eltern ab, sie einzuladen, über Skype eine Geschichte vorzulesen? Man versammelt sich um den Bildschirm und hört der Oma zu. Oder man nutzt die sozialen Medien, um Lebenszeichen zu senden. Warum nicht ein kleines Videotagebuch anlegen, das dem Opa digital zugesandt wird? Viele haben Handys. Wichtig ist, Verbundenheit zu signalisieren! Es reicht das Zeichen, das regelmäßig kommt und mit einem Gefühl verbunden ist: Unsere Freuden und Sorgen zu teilen lässt am Leben teilhaben.
Mit welchen Thematiken beschäftigt sich die EFL regulär?
Höfl: Wir beraten in sämtlichen Partnerschafts-, Ehe-, Familien- und Lebensfragen und bieten eine sog. “emotionsfokussierte Paartherapie“, die nach aktueller Forschung das Scheidungsrisiko um die Hälfte senkt. Wir werden größtenteils durch die Kirchensteuer bezahlt.
Gibt es deswegen Beratungs-Voraussetzungen?
Höfl: Nein, wir beraten alle, ob gläubig, konfessionslos, atheistisch, ob hetero- oder homosexuell. Wir haben auch immer mehr mit gleichgeschlechtlichen Paaren zu tun.
Interview: Daniela Stattenberger